Richard Ford mit »Valentinstag« auf der LitCologne –
»Ugly? No, you should see places like Rapid City.« Für Köln hat der sichtbar heiter gestimmte Gast tröstende Worte. Wie in jeder Aufwärmphase im Gespräch mit US-Amerikanern wird eingangs Geografisches ausgetauscht und den Veranstaltungssaal in der Flora findet Ford einfach nur »gorgeous«.
Richard Ford hat in allen Gegenden der USA gewohnt und ich finde es beruhigend, dass auch so ein kluger Kopf sich nicht sicher ist, ob die derzeitige Wohnsitz-Entscheidung eine gute war. Angela Spizer macht ihn darauf aufmerksam, dass er noch im Frühjahr dem Spiegel im Interview gesagt hat, wie glücklich er mit dem Umzug vom Norden der USA zurück nach New Orleans sei. Ford dazu: »Maybe I lied to Der Spiegel«.

Dass manche Entscheidungen sich sogar dem eigenen Urteil entziehen, plagt auch Frank Bascombe in »Valentinstag«, seinem wahrscheinlich letzten Romanauftritt als Richard Fords bekanntester Protagonist. Bascombe arbeitet auch mit 74 noch als »Hausflüsterer« bei einem ehemaligen Angestellten, der ursprünglich aus Tibet stammt und an den er sein eigenes Immobiliengeschäft einst verkauft hat. Das ist eine von vielen Anspielungen auf die Geschäftstüchtigkeit der Eingewanderten, die Amerika sozusagen mit dessen eigenen turbokapitalistischen Waffen schlagen.
Franks Sohn Paul, 47, ist an ALS erkrankt und der Wettlauf mit dem nahen Tod gerät für Sohn und Vater zu einer Art Projekt, einem gemeinsamen Beschäftigungsprogramm. Frank begleitet Paul durch eine Studie an der Mayo-Klinik in Minneapolis und nimmt an Seminaren für »neuerdings Pflegende« teil, um keine Fehler im Umgang mit dem Todkranken zu machen. Einen Sohn, den Erstgeborenen, hat er bereits vor Jahrzehnten, verloren, als der noch ein Kind war. Darüber ist seine erste Ehe zerbrochen, die erste Frau (die auch Pauls Mutter war) ist inzwischen verstorben.
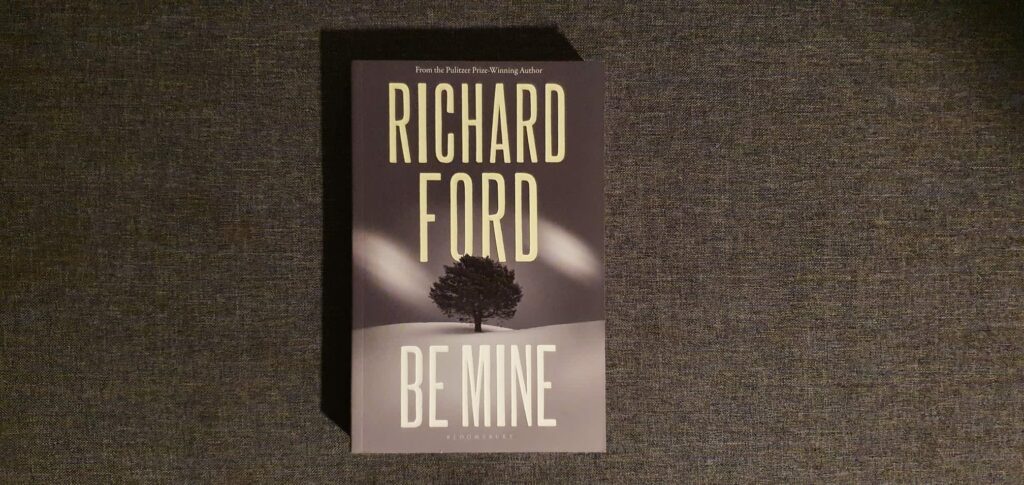
Frank betreibt eine unverbindliche Beziehung zu einer vietnamesischen Masseurin, der er zum Valentinstag sogar einen Antrag macht, nur um zu erfahren, dass er nicht der Erste mit dieser Idee an dem Tag ist und sie gedenkt, bald einen Landsmann zu heiraten, um mit ihm in der Heimat ein Hotel aufzumachen. Soweit zu amerikanischer Selbstüberschätzung der eigenen Attraktivität (bzw. die der USA als Business-Standort).
»Be mine«, so der wesentlich facettenreichere Originaltitel, impliziert Besitzergreifen, aber auch die Süße, die in der Abhängigkeit voneinander steckt. Auf den kleinen Zuckerherzen, die in den USA zum Valentinstag gerne verschenkt werden steht: »Be mine« und Ford erklärt, dies heiße natürlich umgekehrt auch: »Ich bin dein« und gelte in dieser Interpretation besonders für Frank Bascombes Hingabe an seinen Sohn.

Nach einem vorerst abschließenden Patientengespräch in der Mayo-Klinik brechen Vater und Sohn in klirrender Kälte mit einem verranzten Wohnmobil namens »Warmer Wind« nach South Dakota auf. Ziel ist Mount Rushmore, der Vier-Präsidentenköpfe-Felsen, der so ziemlich das kitschigste all-American Ziel einer letzten Reise ist, das sich ein US-Schriftsteller ausdenken kann. Es ist nicht der Wunsch von Paul, der sich sonnigere, wenngleich für seinen Zustand mittlerweile zu weit entfernte Ziele, vorstellt. Vielmehr verfolgt Frank, wie Eltern das so oft tun, seine eigenen Vorstellungen mit dem angeblich pragmatischeren Reiseplan. In Wirklichkeit geht es Frank wohl auch um seine eigene Geschichte, denn er war in den Fünfzigern mit seinen Eltern am Mount Rushmore.
Paul schont ihn nicht, sondern formuliert in seiner Endzeitstimmung Fragen an Frank, die so noch nie aufgekommen sind, z.B.: »Wie geht es dir damit, Vietnam verpasst zu haben?« Nach der ersten Verblüffung stellt sich Frank genau dieser glücklichen Fügung des Schicksals, die eine Wehruntauglichkeit mit sich bringen kann. Bei einem Klassentreffen hatte er anhand seiner Weggefährten festgestellt, »dass es reine Glückssache ist, ob man über seine Anfänge hinauskommt oder nicht«.
Seinen Übersetzer Frank Heibert hält Ford für »ein Genie« und bei der sprachlichen Dichte von »Valentinstag« sind Attribute wie »hinrichtungskammergrünes Linoleum« oder »blassen Irrenhaus-Braun« des Wohnmobils wahrscheinlich noch die harmloseren Herausforderungen. Ford erklärt, dass er durch seine Legasthenie als Kind zu besonders langsamem Lesen gezwungen war und vermutet, dass er deshalb die Schönheit von Sprache um so deutlicher erfahren hat. Man kann sehen, wie angetan er von Ulrich Noethen ist, der seinen Text auf Deutsch zum Klingen bringt.

Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass Ford die alte Analogie von Mark Twain bemüht hat, die ich zum Ausgangspunkt meiner eigenen Website lightning-bug.de gemacht habe. Dass nämlich der Unterschied zwischen dem richtigen und dem fast-richtigen Wort der zwischen »lightning« und »lightning bug« ist. Für einen manischen Wortklauber wie Ford, der erst drei Jahre lang Notizbücher vollschreibt, bevor er sich an den ersten Satz macht, ein mahnendes Bild. Für mich war es die Aufforderung zum Pragmatismus: lieber lauter Glühwürmchen als gar kein Licht.
Ford sagt, er habe ein Buch schreiben wollen, das gleichzeitig traurig und »extremely funny« sein sollte. »Der Weg ist das Ziel« sei in diesem Roman eine pragmatische Schutzbehauptung, erklärt er, denn der Tod eigne sich ja kaum als Sehnsuchtsziel. Aber wenn diese Reise schon so hart sein musste, wollte er sie »useful« machen und »inspiring«. Eine, auf der die Figuren sich selbst und einander erlösen können. Eine Art Erlösung entsteht durch die neue Vertrautheit zwischen Vater und Sohn (»Blickkontakt nicht nötig«). Auch wenn mit jeder Meile spürbar wird, dass man »im Allgemeinen […] die Dinge am Ende nicht mehr repariert« bekommt.
Richard Ford, Valentinstag, Roman, aus dem Amerikanischen übersetzt von Frank Heibert, Hanser Berlin. 384 Seiten. Erschienen am 21.8.23

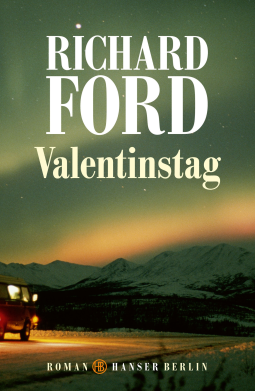


Schreibe einen Kommentar