Vor 110 Jahren, am 4.4.1914, wurde Marguerite Duras in Saigon geboren, das zu dieser Zeit 182.000 Einwohner hatte. 70 Jahre später erschien »L’Amant«, eines ihrer bekanntesten Werke, das 1984 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde.
An Ostern 2024 laufe ich durch Ho Chi Minh City, »L’Amant« im Gepäck, und versuche zu ahnen, was in dieser 11 Millionen-Boomtown noch von dem alten Saigon übrig ist. Von den Verwaltungseinrichtungen der Franzosen, vom Chinesenviertel und der Mädchenschule, vor der die 15jährige Hauptfigur von ihrem 27jährigen Liebhaber nach den gemeinsam verbrachten Nächten abgesetzt wird.
Sie, Tochter einer alleinerziehenden verarmten französischen Grundschullehrerin, aber von weißer Hautfarbe, was ihr in der Kolonial-Hierarchie einen Platz sichert. Er, der Sproß einer der reichen Cholon-Chinesen-Familien, die bei Franzosen wie Einheimischen gleichermaßen unbeliebt waren.

Die ersten 40 Seiten von »L’Amant« sind ein einziges retardierendes Moment, das auf die erste Begegnung hinmäandert wie die Arme des Mekong-Deltas. Es ist das Ende der Sommerferien und eine 15jährige Gymnasiastin fährt mit der Fähre zurück in ihr Internat nach Saigon. Während das auffällig gekleidete Mädchen an der Mekong-Fähre bei Sadec beschrieben wird, unterbrechen Schilderungen familiärer und historischer Hintergründe den Beobachtungsfluss und mit aufreizender Langsamkeit wird diese erste Einstellung ausgebreitet und erste Blicke ausgetauscht.
So wie später in Jean-Jacques Annauds berühmter Verfilmung von 1992, fährt die Erzählerin in der 3. Person mit dem distanzierten Blick einer Kamera um die Hauptfigur herum und lässt ein präzises Bild von ihrer eigenwilligen Aufmachung entstehen. Ausführlich wird über Herkunft und Wirkung des verschossenen Seidenkleides und der abgetragenen Lurex-Sandalen berichtet und über den Clou des Outfits, einen alten roséfarbenen Männer-Filzhut.
Die kecke Teenagerin merkt, dass sie beobachtet wird, aber bevor sich die Tür der schwarzen Limousine tatsächlich für sie öffnet und die schicksalhafte Verbindung beginnt, erfahren wir von der Armut ihrer Herkunftsfamilie, der Dumpfheit und Brutalität der Brüder, besonders des von der Mutter verhätschelten Ältesten, der sich in den Opiumhöhlen herumtreibt und nie ein eigenes Einkommen haben wird.
Es gibt Berichte aus der Vergangenheit und Vorgriffe auf die Zukunft der überforderten Mutter, die in der Beziehung ihrer Tochter zu dem Chinesen gleichzeitig Schande und die Chance sieht, Geld ins Haus zu holen. Ihr verstorbener Mann hat den Besitz in Frankreich verspielt, sie selbst sich mit einer Grundstücksbeteiligung in Vietnam übers Ohr hauen lassen. Die kleine Familie ist also bankrott und ihr Grundschullehrerinnen-Gehalt wirft kaum genug ab, um den Kindern Bildung zukommen zu lassen.
Der autobiografische Roman verrät in seinem sprunghaften, manchmal unverbunden wirkenden Erzählstil etwas über Duras‘ eigene Sprachentwicklung. In den ersten zehn Lebensjahren habe sie fast ausschließlich Vietnamesisch gesprochen, sagte Duras selbst dazu, und das habe sich auf ihren späteren Satzbau ausgewirkt.
Noch selbstbewusster, als die Schülerin ihrem neuen Bekannten in seine Jungesellenwohnung im chinesischen Viertel von Saigon folgt, kommt sie wieder heraus. Die Erzählstimme wechselt unvermittelt in die Ich-Perspektive, als ob diese neue Frau sagen wollte: »Seht her, Welt. Jetzt bin ich in meinem eigenen Leben angekommen.«
Marguerite Duras, »L’Amant«, Reclam Fremdsprachentexte Französisch, herausgegeben von Karl Stoppel, 167 Seiten. Erschienen 1984 bei Les Éditions de Minuit, Paris.

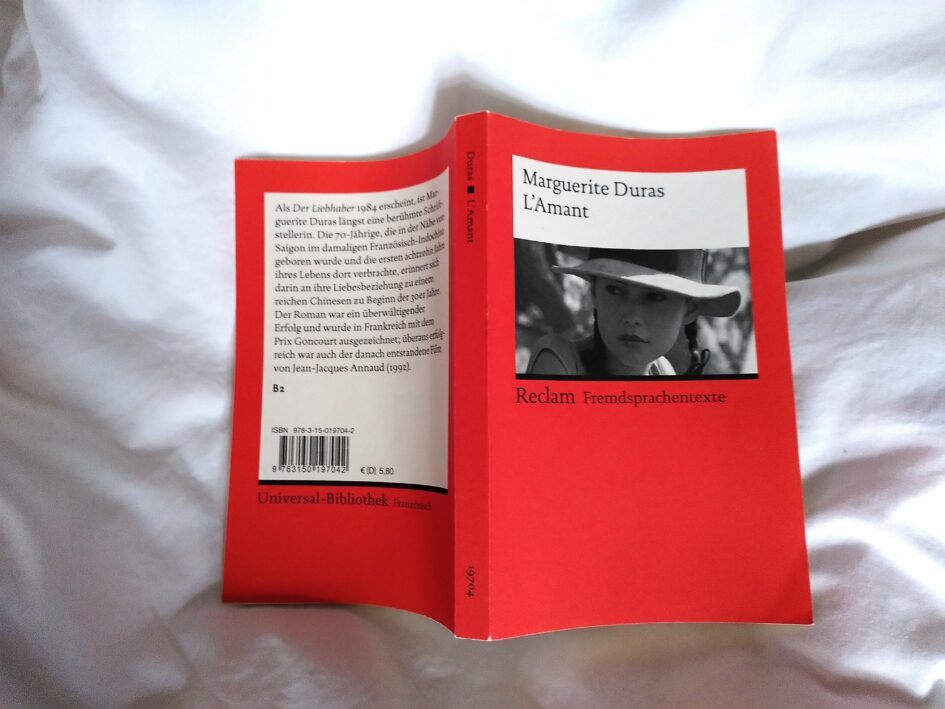


Schreibe einen Kommentar