Seit ich Jonas Hassen Khemiri auf der Buchmesse 2023 in Göteborg zuhörte, habe ich ungeduldig auf die deutsche Übersetzung seines neuesten Romans gewartet. Oder alternativ darauf, dass meine schwedischen Sprachkenntnisse endlich für die 736 Seiten »Systrarna« reichen. Was immer eher eintreffen möge. Nun ist beides gleichzeitig eingetroffen. Ich habe mir in Stockholm »Die Schwestern« im Original gekauft und Ursel Allensteins Übersetzung kam heraus.
Meine Erwartungen waren durch die Lobeshymnen deutscher Rezensionen inzwischen noch gestiegen. Als »Sprachmagier« à la Tschechow bezeichnet Dirk Fuhrig Khemiri gar im Deutschlandfunk. Und lobt die stringente Struktur des Romans. Die über 30 Jahre (ausgehend von der Jahrtausendwende) hinweg ausufernden Lebensgeschichten von Ich-Erzähler Jonas und seinen ehemaligen Nachbarinnen, den drei Mikkola-Schwestern und ihrer Mutter, lassen viel Raum für multiple Erzählstränge und deren konsequent abwechselnden Kapitel.
Schon früh erinnerte mich Jonas an Ina, die älteste, etwas zwanghaft geratene, Schwester. Mit einem ausgeklügelt strukturierten Wäschesystem versucht sie, ihren jüngeren Schwestern Anastasia und Evelyn etwas Haushaltsdisziplin in der gemeinsamen Wohnung beizubringen. Der Kontrollzwang Inas als Reaktion auf fließende Identitätszuweisungen, Familiengeheimnisse und -flüche ist jedenfalls sehr glaubhaft und die Romanstruktur spiegelt dieses Bedürfnis nach Ordnung. Khemiri versucht ein einziges Mal, bei einem besonders verstörenden Ereignis, disruptiv zu sein und schreibt ein Kapitel, das nur einen einzigen Satz enthält. Das wirkt eher aufgesetzt, technisch.
Außerdem liest sich Khemiri trotz seiner Fabulierfülle nicht besonders literarisch. Es gibt kaum Stilmittel. Keine Metaphern, die sofort im Gedächtnis bleiben, keine Vergleiche, die man sich gleich unterstreichen möchte. Dieses Phänomen teilt er mit einigen zeitgenössischen Bestseller-Autor:innen, die in Schweden häufig aus dem Journalismus kommen. Aber Khemiri kommt (auch) vom Theater. Was ist also die Botschaft, die Vision? Die Gesellschaftskritik?
Stattdessen gibt es MeToo-Anekdoten aus dem Universitäts- und Kulturbetrieb. Dass die schwedische Literaturszene eitel, korrupt und voller Sexgeheimnisse ist, weiß die Welt spätestens seit dem Nobelpreisskandal um die schwedische Akademie. Zur Erinnerung: 2018 führte ein Skandal um sexuelle Belästigung und Korruption in der Literatur-Jury dazu, dass die Verleihung des Preises für ein Jahr ausgesetzt wurde. Man wollte sich Zeit nehmen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen (aka Gras über die Sache wachsen zu lassen). 2019 wurden dann zwei Nobelpreise verliehen.

In »Die Schwestern« werden in der Literaturwissenschaft der Uni Stockholm junge Studentinnen von ihrem, ziemlich berühmten, Professor fürs Bett rekrutiert. Sein Mitarbeiter Hector, Inas Ehemann, verliert seine Stelle, weil er den Skandal anspricht. Witzig ist, dass Hector damit eine Studentin beeindrucken will, die ihn beeindruckt.
Aber was ergibt sich jetzt aus der Anekdote? Mir fehlen bei Khemiri die Schlussfolgerungen. Wie stellt sich die Erzählstimme zum Erzählten? Sie entbehrt, eigentlich das ganze Buch hindurch, einer erkennbaren moralischen Grundlage. Dadurch wird die Verwendung von derlei Missständen beliebig und bleibt ohne Konsequenz (außer für Hectors und Inas Privatleben).

»Die Schwestern« liest sich wie ein endloses Coming of Age aller Beteiligten weit in die Dreißiger hinein. Besonders die (Selbst-)darstellung des Schriftstellerdaseins nimmt für mein Empfinden zuviel Raum ein. Da lese ich lieber Benedict Wells, der sich ohne Stipendium in Berlin über Wasser halten musste und sich keine monatelangen Schreibblockaden in den Cafés der Stadt leisten konnte. Mich lassen diese immergleichen selbstreferentiellen Schriftsteller-Lebensgeschichten meistens etwas ratlos zurück. Sollen wir nun Zeuge einer ganz besonderen, individuellen Entfaltung eines Ausnahmetalents werden oder Zeuge des universellen Phänomens des Künstler-Werdens?
Khemiri mäandert von Erinnerung zu – vielleicht erfundener – Erinnerung und das alles bleibt ohne Ergebnis, ohne Einsicht und erst recht ohne Vision. Außer einer und die ist ziemlich peinlich.
Die große romantische Liebe trifft den Erzähler spät und prompt ist, rückblickend betrachtet, auf diesen Urknall zu warten die einzig wahre Möglichkeit, eine Partnerschaft einzugehen. »Mein ganzes Leben hatte ich zu hören bekommen, dass etwas mit mir nicht stimmte, Ex-Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder, alle waren sich erstaunlich einig, du wirst nie die eine treffen, den perfekten Menschen gibt es nicht, in der Liebe geht es darum, seine Träume anzupassen und genügsam zu sein.«
Und dann hat er es ihnen so richtig gezeigt: »ihr wart die Idioten, die sich zu früh zufriedengaben, die ihre Ansprüche herunterschraubten, die bei ihren ersten Dates hockten, die sich verlobten und zum Altar gingen und die Kaufverträge fürs Einfamilienhaus unterschrieben, die Testamente aufsetzten und für das Alter sparten, ihr habt euch eingebildet, dass ihr glücklich seid, obwohl ihr es nie wart.«
In your face, ihr Spießer! Der irre Introvertierte mit seiner verworrenen Familiengeschichte hat es als einziger richtig gemacht: »denn in eurem tiefsten Inneren wusstet ihr, dass dies nicht der richtige Mensch war, denn dort draußen gibt es jemand anderen, der eure Welt vervollständigen kann, und es ist eure Lebensaufgabe, diesen Menschen zu finden.« Was soll denn diese alberne Publikumsbeschimpfung nach Hollywood-Kriterien?
Am Ende teile ich meine Einschätzung mit Evelyn, nachdem sie das Erstmanuskript von »Die Schwestern« gelesen hat. Das autofiktionale Format in diesem Roman funktioniert gar nicht. Es irritiert. Nicht nur die Beteiligten. Und noch etwas sagt Evelyn zu Jonas. »Du erinnerst mich an Ina«.
Es ist auch unbefriedigend, dass nicht alle Rätsel in »die Schwestern« gelöst werden und es loose ends aus den vielen Nebenplots gibt. Das ist genau so ärgerlich wie einzelne Socken in der Wäsche.
Jonas Hassen Khemiri, Die Schwestern, aus dem Schwedischen übersetzt von Ursel Allenstein, Rowohlt, 736 Seiten. Erschienen am 15. Juli 2025.
Liebhaber:innen schwedischer Entwicklungsromane in kompakterer Form, schlage ich gerne Ia Genbergs »Die Details« vor. Eine Coming-of-Middle Age-Geschichte in vier zentralen Beziehungen auf nur 144 Seiten mit Stockholm-Flair und Jahrtausendwende. Alles drin.



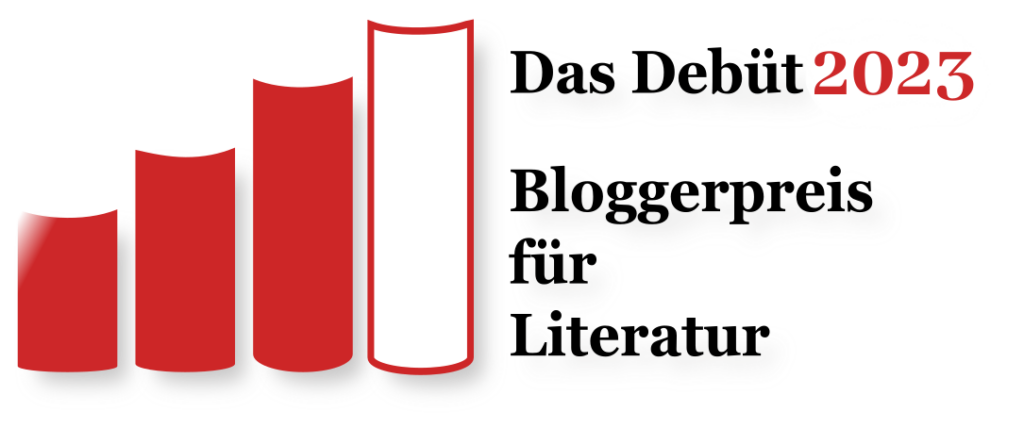
Schreibe einen Kommentar