Ja, ich weiß, heute beginnt die Frankfurter Buchmesse und ich sollte davon berichten. Zumal ich schon vor Ort bin. Aber lieber beschäftige ich mich nochmal mit »Was wir wissen können«. Und als ich in der Rezension des österreichischen Standard lese, McEwan schildere den »Dichter-Olymp als Brutstätte systemischer Gockelei«, denke ich: Na also, passt doch!
Drei große Themen behandelt McEwan in seiner Zukunftsschau: den Zustand der Literatur (-wissenschaft) und der (englischen) Sprache, den Zustand von Welt und Umwelt und den Zustand von Liebe und Ehe. Um es gleich vorwegzunehmen: bei Letzterem ändert sich am wenigsten. Auch im 22.Jahrhundert wird geliebt, gelogen, vergeben und vergessen. Wie tröstlich!
Ich-Erzähler Tom ist Historiker und lebt im England des Jahres 2119. Aber eigentlich lebt er in zwei Welten. Denn er forscht zu einem Abendessen, das vor hundert Jahren im Hause des Dichters Francis Blundy stattfand. Anlässlich ihres Geburtstags widmete der damals schon berühmte Autor seiner Frau Vivien einen Sonettenkranz. Das Werk ist nur einmal, bei eben dieser Dinnerparty, vom Dichtergatten selbst uraufgeführt worden und seit hundert Jahren unauffindbar.
Tom versinkt bei seinen Recherchen in der Vergangenheit. »Ich hätte dort sein können. Ich bin dort. Ich weiß alles, was sie wissen – und mehr noch, denn ich kenne einige ihrer Geheimnisse und ihre Zukunft, ihren Todestag.«
Was er nicht weiß, ist, dass der Sonnettenkranz für Vivien soviele Geheimnisse enthält wie er später durch sein spurloses Verschwinden erzeugt. Tom ist zwar besessen von dem Gedanken, das Gedicht aufzutreiben, aber die Aufgabe stellt ihn vor große Hindernisse. Inzwischen ist als Folge des Meeresanstiegs aus Großbritannien ein Archipel teilweiser unbewohnter Inseln geworden und das Reisen beschwerlich. »Natürlich würde mir die Moidart-Bibliothek eine große Hilfe sein, aber die Fahrt dahin war einfach zu gefährlich. Ich scheue Risiken heute noch mehr als mit zwanzig oder dreißig, und ich war nicht bereit, mein Leben an eine Horde Lake-District-Gangster in elektrischen Kanus zu verlieren.« Eine der vielen Stellen in »Was wir wissen können«, die laut lachen und ahnen lässt, wieviel Spaß McEwan beim Schreiben hatte.
»Klimawandel« sei der »verharmlosende, damals noch gebräuchliche Ausdruck« im 21. Jahrhundert gewesen und »wilde Ausbrüche« habe es in der Lebensweise der Menschen gegeben: »was für ein Humor: für eine Woche Urlaub dreitausend Kilometer fliegen; Hochhäuser, die an Wolken kratzten; uralte Wälder abholzen für Papier, mit dem sie sich den Hintern abputzten«. Allerdings hätten diese Menschen auch bahnbrechende Errungenschaften in Medizin und Technik auf den Weg gebracht, ohne jedoch in der Lage zu sein, die nötigen Maßnahmen gegen ihr eigenes Verderben in die Wege zu leiten. Yep, das sind dann wohl wir.
Eine witzige Konstante im Zeitalter der »Disruption« bleibt der Universitätsbetrieb. Auch Tom und seine Frau June verdienen als Literaturwissenschaftler einen Bruchteil dessen, was Naturwissenschaftler bezahlt bekommen und die Jugend ändert sich sowieso nie, wie Tom in seinem Seminar »Literatur der Überflutung« feststellen muss: »Vierzehn junge Frauen und Männer hingen in sich zusammengesunken um den Tisch. Sie waren mit den Folgen aufgewachsen, hatten schon ihre Großeltern endlos darüber reden hören. Die Vergangenheit war bevölkert von Idioten. Wen interessiert’s? Das Thema war abgehakt. Die jungen Leute saßen hier, weil der Kurs Pflicht war«
Was die Jugendlichen wirklich fesselt ist ihre Social-Media Zeit mit der Nationalen Künstlichen Intelligenz. »Bis in die intimsten Einzelheiten kennt die NKI das Leben des Fragenden, und ihr Gedächtnis reicht natürlich weit zurück. Den Kids gefällt das. Sie kommen sich wichtig vor, fühlen sich gekannt und umsorgt. […] NKI ist eine freundliche Tante, besorgt, kritisch, weltgewandt. Die Jugendlichen gestehen ihr, was sie selbst Eltern oder engsten Freunden nicht anvertrauen würden«.
Was in den vielen wohlwollenden Kritiken zu Was wir wissen können viel zu kurz kommt, ist McEwans ehrenhafter Versuch einer weiblichen Perspektive im zweiten Teil des Romans, der Viviens Aufzeichnungen enthält. Durch ihre Erzählstimme entsteht ein unterhaltsam satirisches Portrait von Dichterfürsten-Eitelkeit aus der Sicht der Begleiterin. »Ich bin in Dein Leben getreten«, beginnt Vivien ihre Abrechnung, »du nie in meins«. Nüchtern analysiert sie ihre Lebensrealität als Muse/Sekretärin/Lektorin/Köchin/Bettgenossin. »[…] was hier vorging, war ein Prozess des Verschwindens. Ich war es, als ich die Fahne las, dann war ich es und zugleich auch nicht, als ich das erste gedruckte Exemplar in Händen hielt, bis ich schließlich, verwässert und auf viele gedruckte Versionen meiner selbst verteilt, im Druckbild verschwand und es gar nicht mehr um mich ging«.
Ist das vielleicht auch ein wenig die Abbitte des Romanciers McEwan bei seiner eigenen Lebensbegleiterin? »Was blieb, war nicht mal eine Frau, sondern eine poetische Übereinkunft, der Schatten einer Frau an der Höhlenwand der Imagination eines Mannes.«
Ian McEwan, »Was wir wissen können«, Roman, aus dem Englischen von Bernhard Robben, Diogenes, 480 Seiten. Erschienen am 24.09.2025

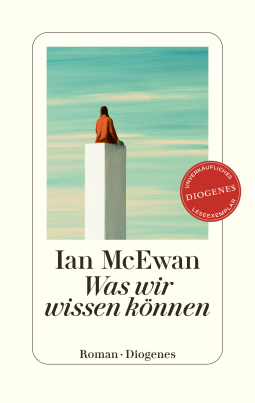

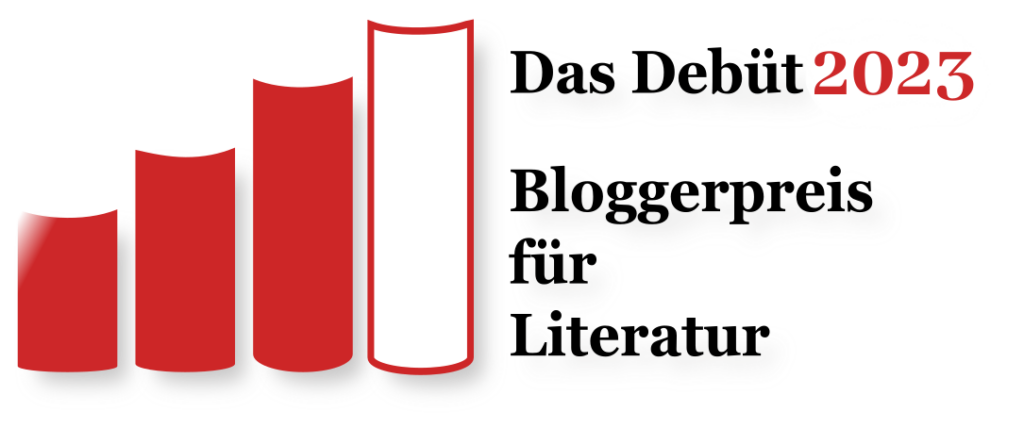
Schreibe einen Kommentar