»Mir ist in allen meinen Welten kalt«. Ich-Erzählerin Unni fühlt sich zerrissen zwischen ihrer Herkunft und ihrer Sozialisation. Sie stammt aus dem samischen Norden Finnlands und muss ihre Heimat verlassen, als die Eltern sich trennen und der Vater in Suomi (finnisch Lappland) zurückbleibt. Nur in den Ferien kann sie ihn besuchen und wieder in die Stille ihrer Heimat eintauchen.
Als Erwachsene bemerkt sie bei ihren Besuchen am finnischen Polarkreis die klimawandelbedingte Veränderungen der Landschaft. »Ich hatte mir vorgestellt, das Zuhause meiner Kindheit würde immer bleiben, wie es war. Aber nur das Haus blieb, die Welt um es herum schmolz und wurde verzerrt. […] die großen Permafrost-Erhebungen […] waren eingebrochen, aufs Wasser gesackt wie aufgeschlitzte Tiere.«
Unni wird Geologin und spezialisiert sich auf das, was sie von jeher fasziniert: Eis. »Das Klima der Gletscher kann man fast nicht beschreiben, es ist eine sture, von der übrigen Welt losgelöste Kälte, die man erst versteht, wenn man selbst mittendrin ist.«
Jon wächst als Kind kanadischer Ureinwohner bei seinen Adoptiveltern in Dänemark heran und spürt schon früh »eine Trauer, die nicht einmal seine eigene war, sondern die eines anderen, aber die trotzdem in seinem Blut zirkulierte, sich zwischen Herz und Wirbelsäule zusammenballte und mit ihm erwachsen wurde«.
Erzählt wird in dem Roman zwar die Geschichte von Unni und Jon, aber die dritte Hauptperson heißt Penny. Das ist der Gletscher im kanadischen »Auyuittuq«, dem Land, »das niemals schmilzt«. Wissenschaftlerin Unni hat bei ihren Expeditionen den Eindruck, dass der Gletscher lebt und »dass er sich über meinen Bohrer und meine Steigeisen amüsiert.« Sie vermutet, dass im Innern seiner sechstausend Quadratkilometer Eis Gletschermühlen am Werk sind, d.h. Penny von innen her schmilzt.
Wo kein Kompass funktioniert
Vor dieser Kulisse treffen sich Unni und Jon und die Liebe selbst wird zur Naturgewalt: »so nah kam mir Jon, und er brachte die ganze Welt mit, ich bestand nur noch aus Flusswasser und Plasma, Knochenmark und Schweiß.« An diesem Ort, an dem kein Kompass mehr funktioniert, weil der Nordpol zu nah ist, gelingt es Unni und Jan nicht, sich aufeinander einzunorden. Nach ein paar Tagen reist Unni wieder ab, nur im darauffolgenden Jahr wiederzukommen und überall nach Jon zu suchen.
Wenn Markkula den Prolog nicht geschrieben hätte, wäre diese Suche auch spannend. Aber gleich auf der ersten Seite des Romans wird Jons Schicksal vorweggenommen (ein Suizidversuch) und dieser Schatten legt sich über die ganze folgende Erzählung.
»Wo das Eis niemals schmilzt« besticht durch die Sprache, die poetische Kraft, mit der Markkula alles Leben auf der Erde miteinander verbindet: »der Ruf des Wals ist ganz charakteristisch, so traurig und stark, dass er allen anderen Lauten die Kraft nimmt. Er hat die Farbe erstarrten Wassers und kommt nicht nur aus dem Inneren des riesigen Meeressäugetiers, sondern aus dem Kern der Welt, aus der Urheimat aller Rufe.«
»Englisch schmeckt wie getrockneter Fisch«
Es ist die Sprache, die Menschen in dieser Geschichte verbindet oder trennt. Als Unni zwei Monate zu früh in Rovianemi zur Welt kommt, dem Ort, der international bekannt ist als Wohnsitz des Weihnachtsmannes am Polarkreis, können sich ihre Eltern für sie »keinen anderen Namen als Unni denken, weil das in der nordsamischen Sprache „das Kleine” bedeutete. Und auch wenn mein Vater die Sprache seiner Eltern vergessen hatte, weil sie ihm in der Schule ausgewaschen worden war, existierte ich für ihn in dieser Sprache.«
Später, als sie Jon trifft, fällt Unni auf, dass er viel besser zuhören als reden kann und ist dankbar dafür. »Jon unterbrach mich kein einziges Mal. Wenn ich kurz schwieg, wartete er ab. Er versuchte, meinen Worten nicht das Gewicht zu nehmen, sondern nahm sie entgegen, wie sie waren.«
Als Produkt kanadischer Zwangsassimilation in den Sechzigern und Siebzigern, trägt Jon nicht nur das Aussehen, sondern auch die Sprachvergangenhheit seiner Ahnen weiter, ohne Zugriff darauf zu haben. Die Inuit-Hebamme seiner leiblichen Mutter erklärt: »Englisch schmeckt wie getrockneter Fisch. Aber unsere Sprache, die schmeckt nach Zwergheidelbeeren und Mariengras, und sie duftet nach Weidenrinde und Karibufell, nach Schnee und Eis.«
Dieser Identität versucht Jon nachzugehen, muss aber einsehen, dass, selbst wenn er seine Eltern in Auyuittuq finden würde, keine Kommunikation möglich wäre. »Er stellt sich vor, wie das Gespräch verlaufen würde. Ich bin dein Sohn, würde er sagen, wie in einem Film. [… ] Falls der Mann darauf antworten würde, ginge seine Antwort über die Dolmetscherin, sie würde sich aus zwei Sprachen bilden, aus den Worten zweier Unbekannter. Eine Doppelhelix der Fremdheit.«
Transgenerationelles Trauma
Unni sieht man ihr »Anderssein« zwar nicht an, dennoch wird sie in der Schule fern ihrer nordsamischen Heimat grausam gemobbt. Die Ich-Erzählerin fragt sich: »Oder wussten sie es doch? Spürten Kinder Dinge, von denen ihnen nie jemand etwas gesagt hatte?« Zur gleichen Zeit in Dänemark fragt der kleine Jon seine Mutter: »Mama, warum bin ich so komisch?«
Er bekommt seine Fremdheit schon aufgrund seines Aussehens gespiegelt, wenn sich die Erwachsenen darüber freuen, dass der »kleine Kerl so gut dänisch spricht«. Seine Adoptivmutter Helen und ihr Mann hatten Kanada verlassen, um Jon in Dänemark unbelasteter aufwachsen zu lassen. »Kanada war ein schönes, friedliches, extrem weit in den Norden reichendes Land, in dem glückliche Menschen in gepflegten Häusern lebten und sich auf der Straße fröhlich gegenseitig fragten, was es Neues gab.«
In dieser scheinbar heilen Welt bekommt Helen, die nicht schwanger werden kann, eines Tages einen Säugling zur Adoption angeboten. »Aber inmitten von alldem gab es ein anderes Kanada, wie ein unerwarteter Wind in den Wipfeln oder wie ein Fluss, der in die falsche Richtung floss, […] andere Wörter hinter den Wörtern. Hinter den glücklichen Mittelschichtsmenschen gab es ein Land, das seine Minderheiten in Internate sperrte und dem Unrecht, das ihnen widerfuhr, nicht nachging. Ein Land, in dem als mutig, lieb und schön beschriebene Kinder auf Zeitungsfotos lachten, während ihre Eltern gleichzeitig als wüst, verrückt und versoffen abgestempelt wurden. Dieses Kanada braucht Jon nie zu Gesicht zu bekommen, beschließt Helen«
Die kurze geschichtliche Einordnung von Zwangsadoptionen in Kanada und Assimilationspraktiken in Finnland am Ende des Buchs ist ausgesprochen hilfreich. Zum Klimawandel hingegen brauchen wir ja mittlerweile keine Hintergrundinformationen mehr. Wir müssen nur noch zuschauen.
Ich lese »Wo das Eis niemals schmilzt« in Kanada und als ich damit fertig bin, gehe ich mit einer Bekannten zum Schwimmen in einem der Bergseen, mit denen British Columbia so reich gesegnet ist. Auch jetzt im September ist die Temperatur immer noch angenehm zum Planschen. Plötzlich hält sie inne und deutet auf einen der höheren Gipfel in der Ferne: »Komisch. Mir ist so, als ob da oben sonst das ganze Jahr über Schnee lag.« Ja. Genau.
Inkeri Markkula, »Wo das Eis niemals schmilzt«, Roman, aus dem Finnischen übersetzt von Stefan Moster, Mare, 352 Seiten. Erschienen am 09.09.2025.

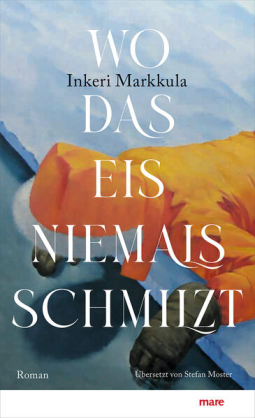

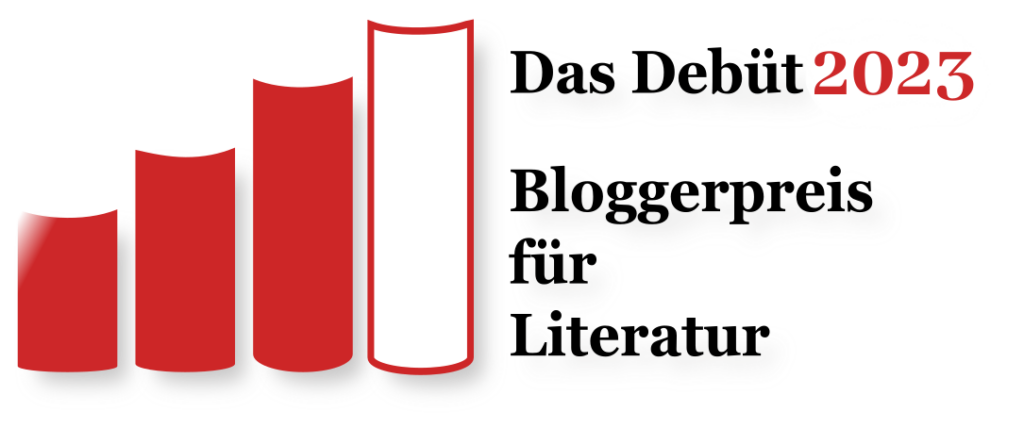
Schreibe einen Kommentar