First World Problems im Lockdown –
Eine wohlhabende US-Ostküsten-Clique gerät durch Covid unter Stress. Die Ich-Erzählerin soll das Apartment ihrer schwangeren Freundin Iris hüten, die in Palo Alto, Kalifornien, festsitzt, nachdem Covid ausgebrochen und Reisen unmöglich ist.
Das Wort »Apartment« beschreibt nur unvollständig das Designer-Reich, in dem ein zwei Jahre alter Ara ein eigenes Schlafzimmer bewohnt. Ein befreundeter Künstler wurde damit beauftragt, den Raum so zu gestalten, dass die Dschungel-Herkunft des Papageis imitiert wird und ein Regal mit entsprechender Literatur informiert die jeweiligen Vogel-Sitter über arttypische Bedürfnisse.
Eines davon ist Kontakt und so ist es Aufgabe der Ich-Erzählerin, einer Schriftstellerin, die mit ihrem nächsten Roman (und vor allem mit sich selbst) kämpft, das Luxus-Haustier mit dem zu versorgen, das den meisten Menschen in der Zeit des Lockdowns verwehrt ist: menschliche Wärme, Spiel und Gespräche.
Dass die Ich-Erzählerin namenlos bleibt, scheint mir in letzter Zeit Mode geworden zu sein und ist aus (mindestens) zwei Gründen eine ärgerliche Marotte. Erstens müssen die Rezensent:innen dann immer »die namenlose Ich-Erzählerin« schreiben, was unelegant ist, und zweitens wird eine falsche Bescheidenheit vorgespielt, die den Narzissmus der Erzählstimme nur notdürftig bemäntelt.
Denn so namenlos sie sich gibt, so aufdringlich ist die Erzählerin in ihrer ausufernden Bedürftigkeit. Dass sie ihrem jungen Mitbewohner, einer Art Patenkind von Iris, sein veganes Hafer-Karamelleis in einem Essanfall wegschlabbert, spricht Bände.
Dass sie die Leser mit Zusammenfassungen ihrer Lektüre zutextet und die Eindrücke ihres Literatur-Dozentinnen-Daseins nicht anders verarbeiten kann als in langen Zitat-Listen, ist ermüdend. Gibt man in die praktische Suchfunktion des E-Books den Satzanfang »mir gefällt« ein, so erscheinen allein 16 Treffer, die Gedanken von Lieblingsautor:innen mit diesem Einleitungssatz enthalten. Beispiel: »„Mir gefällt Günter Grass’ Definition eines Schriftstellers als »jemand, der sich professionell erinnert.«“ « Ein netter Satz, aber so geht das über mehrere Kapitel mitten in der laufenden Geschichte!
Allen voran wird Joan Didion gehuldigt, die schon bei Elke Heidenreichs »Altern« mit zahlreichen ausgedehnten Lobeshymnen gewürdigt wird. Bei Nunez ist es Didions Essay »Slouching Towards Bethlehem«, der eine ausführliche Textanalyse erfährt. Man ist versucht, dieser Generation von Schriftstellerinnen zu raten, die jeweilige Joan Didion-Leseempfehlung einfach in Form einer Literaturliste hinten anzuhängen.
Auf der Doppelseite 68/69 (E-Book) zähle ich 14 (!) verschiedene Autor:innen mitsamt ihren illustren Zitaten. Wenn es die Absicht war, den eigentlichen Plot dadurch zu verlangsamen, ist das mehr als gelungen. Die Geschichte, die Nunez zu erzählen versucht, klingt vom Set-up her interessanter als sie ist. In die eigene Wohnung der Ich-Erzählerin zieht eine Ärztin ein, die im nahegelegenen Krankenhaus Corona-Patienten behandelt, weshalb die Erzählerin vorerst nicht dorthin zurückkehren kann. Auch nicht, als »Giersch«, wie sie den nervigen, aber sehr hübschen, jungen Mann nennt, irgendwann wieder in Iris’ Wohnung zurückkommt, als sie schon dort eingezogen ist.
Der Apartment-Ringtausch verspricht mehr Konflikt als dann tatsächlich stattfindet. Der Übergriff auf die fremden Kühlschrankinhalte ist in dieser Hinsicht schon der Höhepunkt. Es geschieht auch viel weniger Annäherung als der Klappentext vermuten lässt. Es sei denn, man hält gemeinsames Kiffen auf dem Sofa schon für unerlaubte Intimität zwischen den Generationen.
Der Junge, Anfang zwanzig und angeblich ein trouble maker par excellence, ist in dieser Geschichte noch der Normalste. Er reagiert auf seine schrullige Mitbewohnerin, indem er ihr einfach containerweise veganes Karamell-Eis in den Kühlschrank stellt. Und als er die Wohnung verlässt und sich wieder auf den Weg macht, tut er das nicht etwa mit ihr, sondern nimmt sich den Papagei zur Gesellschaft mit. Sehr vernünftig.
Immerhin gibt es schöne Erkenntnisse über das Schreiben. Was zählt, so die Erzählstimme, seien nicht die beschriebenen fiktiven Ereignisse. Es sei das, was man beim Lesen erlebt, die Gefühlszustände, die die Geschichte hervorruft. Bei mir waren das vor allem Ungeduld und Genervtsein von so viel schriftstellerischer Nabelschau.
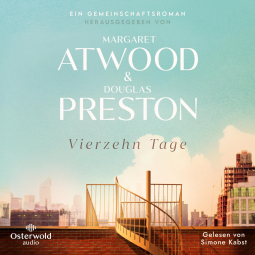
Das viel bessere NYC-Lockdown-Buch ist da der Gemeinschaftsroman »Vierzehn Tage«, herausgegeben von Margaret Atwood, Douglas Preston und der Writers Guild of America. Evolutionsbiologisch gesehen ist das Geschichtenerzählen etwas, das uns als Menschen auszeichnet, und schon vor diesem Hintergrund erinnert das New Yorker Dekameron daran, dass wir auch in unmenschlichen Zeiten Menschen bleiben können.
In dem lebhaften Geschichtenband versammeln sich sowohl exzentrische als auch (scheinbar) unauffällige Bewohner auf dem Dach eines heruntergekommenen Apartmenthauses in Manhattan. Jeden Abend, nachdem sie dem Pflegepersonal der umliegenden Covid-Krankenstationen mit Klatschen, Johlen und Topfschlagen Beifall gespendet haben, erzählt jemand eine Geschichte. Erlebt oder erlogen, gruselig, romantisch oder scheinbar unbedeutend sind diese Episoden, und vor allem ihre Erzähler, viel interessanter als eine alternde, wohlhabende Autorin mit Schreibblockade, die heimlich Hafer-Karamelleis löffelt.
Sigrid Nunez, »Die Verletzlichen«, Roman, übersetzt von Anette Grube, Aufbau, 256 Seiten. Erschienen am 15.01.2024.
Mehr (und Besseres) von Sigrid Nunez hier
Margaret Atwood und Douglas Preston (Hg.), »Vierzehn Tage. Ein Gemeinschaftsroman«, aus dem Amerikanischen von Pieke Biermann, Christine Blum, Susanne Goga-Klinkenberg u.v.a., gesprochen von Simone Kabst, Hörbuch Hamburg, 15 Std. 29 Min. Erschienen am 15.02.2024.

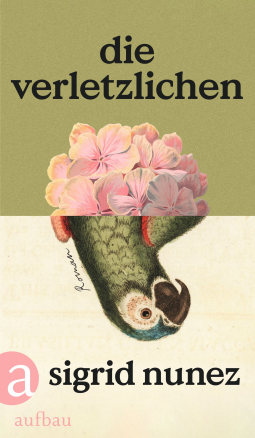


Schreibe einen Kommentar