In Markus Thielemanns »Von Norden rollt ein Donner« gehört Gewalt zur kollektiven Erinnerung. Und holt die Lebenden in Form neuer Bedrohungen wieder ein –
Damit rutscht endlich mal wieder die Lüneburger Heide ins deutsche Kulturbewusstsein. Diese vor über hundert Jahren von Hermann Löns verklärte Ödnis, die von den Nazis gerne instrumentalisiert wurde. Weshalb das heute mit der Heideliebe ein bisschen unbehaglich ist.
Diese Ambiguität passt perfekt zu dem steppenartigen Landstrich zwischen Hannover und Hamburg mit seinem wabernden Herbstnebel. Die darunterliegende Landschaft ist im Winter so grau, dass der NDR im Roman mit Außenaufnahmen auf dem Hof der Schäferfamilie Kohlmeyer wartet, bis ein gnädiger erster Schnee fällt.
Unter dieser Oberfläche, vor allem im Inneren des 19jährigen Heideschäfers Jannes, lodert ein Dauerfeuer an Sinneseindrücken, das den Text selbst zum literarischen Truppenübungsplatz macht. Munster und Rheinmetall sind immer präsent.
Von Ruhe, Eintönigkeit und Langeweile wird zwar gesprochen, aber in Wirklichkeit herrscht für die selbständigen Schäfer Dauerstress. Das liegt auch am Wolf, der im Text nicht nur reale Bedrohung für das Vieh, sondern auch eine Chiffre für politische und klimatische Veränderungen ist.
Jannes ist angeschlagen. Er hat sich für das Leben als Schäfer entschieden, aber nach der Berufsschule bleibt er als Einziger in der Heimat und ist Wind, Wetter und Einsamkeit ausgesetzt. Brombeerdornen oder Wacholder reißen ihm die Hände auf, nach einer Halloweenparty muss er sich übergeben, wird ohnmächtig, fängt an zu halluzinieren oder eben auch nicht. Wer weiß das schon? Er selbst kann die Erscheinung, die offensichtlich nur er sehen kann, nicht zuordnen. Die Zwischenräume, die an diesen Stellen für die Fantasie der Lesenden aufgemacht werden, machen den Roman stark.
Ich vermute, dass diejenigen Passagen, in denen Jannes versucht, durch direktes Nachfragen im Stil von »Opa, wie war das damals?« Klarheit zu bekommen, mit Absicht die schwächsten im Buch sind. Weil sie in ihrer belanglosen Wortwahl die Alltagskommunikation in der Familie und die Sprachlosigkeit markieren, die zu nichts weiter führen als immer wieder derselben Mauer des Schweigens oder Vergessens.
An einigen Stellen, besonders, wenn wir in Jannes Körper stecken, wird die Sprache dagegen außergewöhnlich. So hinterlassen die Begegnungen mit dem Heidegeist, den nur Jannes sieht, eine »saure Traurigkeit, die irgendwann verebbt, ihn in müde Ruhe entlässt, nur damit alles zwanzig Minuten später erneut losbricht.«
Jannes ist über weite Strecken des Buches wie »versunken in die Entzifferung einer obskuren Inschrift« und das tut dem Text gut und macht ihn einzigartig wie Jannes selbst. Die anderen Figuren, allen voran der schwatzhafte, egozentrische Großvater Wilhelm, fallen gegenüber der Hauptfigur steil ab: »Und ein Held war ich« prahlt der Opa, wenn er zum x-ten Mal die Geschichte erzählt, wie er (angeblich) 1948 den letzten Wolf auf der Heide erschossen hat.
Ist es nicht interessant, dass militante Tierschützer, die man, der politischen Denktradition der Achtziger folgend, instinktiv dem grünen Spektrum zuordnen würde, besonders leidenschaftlich den Wolf verteidigen, das Wappentier der Nazis? Und dass so ein paar gerissene Lämmer, immerhin ein prominentes Symboltier unseres christlich geprägten Wertespektrums, ihnen ein fairer Preis für seine Wiederausbreitung zu sein scheinen?
Aber vielleicht sehe ich ja diesen Konflikt zu archetypisch-literarisch. Wilhelm hat noch eine andere Erklärung dafür, dass vor allem Städter sich für die Wiederansiedlung des Wolfes aussprechen: »Das machen die doch nur, damit sie sich weiter wie was Besseres fühlen können.«
Als besonders bedrückenden Teil des Romans empfinde ich die Danksagungen, denn sie weisen direkt auf die Nazi-Vergangenheit einer Landschaft hin, die idyllisch und, mit der Nähe zum KZ Bergen-Belsen, gruselig zugleich ist. Dass Thielemann den Zwangsarbeiter:innen der Rheinmetall-Borsigwerke ein Denkmal gesetzt hat, ist die gesellschaftliche Komponente, die mir in anderen zeitgenössischen deutschen Romanen oft fehlt.
Nach meiner Generation der Kriegsenkel gibt es ja mittlerweile schon die Generation der Kriegs-Urenkel, bei denen die Nazi-Erinnerung nur noch völlig zerstückelt und verfremdet anzukommen scheint. Im Roman ist das genial nachvollzogen durch die Fragmentierung, die Demenz und Verdrängung anrichten. Und die stetig vergehende Zeit natürlich. Während Jannes noch über das seltsame Verhalten des neuen völkischen Nachbars Röder rätselt, erkennen die älteren Leser:innen die alten Muster sofort wieder.
Jannes nimmt intuitiv wahr, dass etwas nicht stimmt, dass es (mindestens) ein Geheimnis in der Familie gibt. Wir können nachvollziehen, wie er an dem Schweigen und Nicht-Wissen leiden muss, aber die Puzzleteile nicht mehr zusammensetzen kann. So, wie er von dem KZ-Außenlager in der Nähe des elterlichen Hofes nur noch das überwucherte Fundament findet, hat er keinen Zugang zum ganzen Erinnerungsgebäude seiner Großeltern mehr.
Nicht alle diese Geheimnisse hätte Thielemann offen lassen müssen. Etwas mehr Aufklärung hätte uns gut getan, aber so ist es natürlich näher an der Realität.
Etwas zu nah an der Realität ist mir das Dauerfeuer an Sinneseindrücken. Ich komme mir vor wie in einer Netflix-Serie, die dramaturgisch gehetzt wirkt. Nasse Kleidung klebt kalt auf der Haut, Jauchefässer stinken und man scheint mir auch nicht zuzutrauen, dass ich weiß, wie ein Schafstall riecht, nasses Fell sich anfühlt und verdreckte Arbeitskleidung.
Ein Blick in Thielemanns Vita erklärt diesen stilistischen Overkill. In den Ausbildungsgängen zum Literarischen Schreiben in Hildesheim und Leipzig scheint man den Studierenden beizubringen, dass Lesende auf gar keinen Fall länger als zwei Absätze lang ihrer eigenen Lebenserfahrung und Vorstellungskraft überlassen werden dürfen.
Auf mich ist diese Detailversessenheit eher verschwendet. Meine eigenen Assoziationen hätten mir an vielen Stellen gereicht. Bei der Dichte von militärischen Sperrbereichen in Ost und West wissen wir älteren Spaziergänger, dass Waffentests sich so unheimlich anhören wie der Donner eines heranrückenden Krieges.
Markus Thielemann, »Von Norden rollt ein Donner«, Roman, C.H.Beck, 287 Seiten. Erschienen am 17.09.2024.

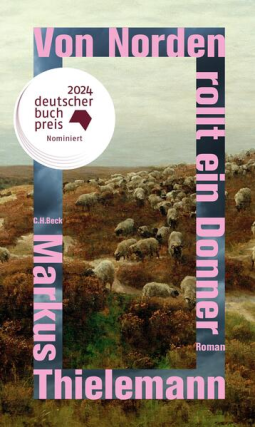


Schreibe einen Kommentar